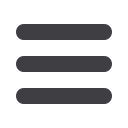

D A S
O P T I M U M
3 5
Farben verändern sich durch un-
terschiedliche Lichtqualität
Farbe als Empfindung gehört nicht
allein der Fläche an, sondern vor
allem dem Raum. Farbe gelangt erst
im Raum zur vollen Entfaltung und
gewinnt durch das Mitwirken des
Lichtes ihre Differenzierung nach
Helligkeit und Dunkelheit. Das Sin-
nesorgan- Auge- macht das Farbse-
hen zum Sinneserlebnis.
Das menschliche Auge hat drei Ar-
ten von Farbrezeptoren, die in ver-
schiedenen Wellenlängenbereichen
empfindlich sind. Diese sind unter
der Bezeichnung Zäpfchen bekannt.
Des Weiteren besitzt der Mensch
noch lichtempfindliche Stäbchen,
die schon bei geringerer Helligkeit
ansprechen und die beim Sehen in
der Dämmerung und in der Nacht
genutzt werden. Sie reagieren auf
die unterschiedliche spektrale Zu-
sammensetzung des Lichtes (Bild 1).
Insgesamt umfasst der Empfindlich-
keitsbereich des Auges 15 Zehnerpo-
tenzen. Die Brechkraft der Linse ist
veränderlich und kann durch Akkom-
modation an verschiedene Entfer-
nungen angepasst werden.
Die vom Menschen betrachteten Ge-
genstände werden auf die Netzhaut
(Retina) am Augenhintergrund abge-
bildet. Die Netzhaut hat an der von
der Einfallsrichtung angewandten
Seite lichtempfindliche Sinneszellen.
Diese Sinneszellen lassen sich in
stäbchen- und zapfenförmige unter-
teilen. Das Auge besitzt 4 -7 Mil-
lionen zapfenförmige Zellen, die an
der Stelle des deutlichen Sehens am
stärksten konzentriert sind.
Die Iris (Regenbogenhaut), die der
elastischen Augenlinse vorgesetzt
ist und von Kammerwasser geschützt
wird, reguliert die Öffnungsweite der
Pupille. Sie kann sich zwischen 1,5
mm und 8 mm verändern. Das gilt
allerdings nur für das jugendliche
Auge. Etwa ab dem 50. Lebensjahr
sinkt die maximale mögliche Pupil-
lenweite deutlich ab.
Im Jahre 2001 ist es Forschern
gelungen, bei der Erforschung der
neuronalen Ursachen für die Steue-
rung der zeitlichen Aktivitäten des
Körpers, wie Tag-Nacht-Rhythmus,
von Hypothalamus des Gehirns
direkte Nervenverbindungen bis in
die Netzhaut des Auges zurückzu-
verfolgen. Hierdurch konnte ein
weiterer Sehzellentyp entdeckt
werden. Der fünfte Zelltyp, der auf
das kurzwellige Energiespektrum
sensibel reagiert, nimmt Einfluss
auf die Produktion des Hormons,
Melatonin, welches die Aktivierung
reguliert und auf die Körperrhyth-
men wirkt.
Am blinden Fleck befinden sich
keine Photorezeptoren. Dort pas-
sieren die Sehnerven, zu einem
Strang vereint, die Netzhaut. Der
Sehnerv leitet elektrische Impulse
weiter. Während man einer einzel-
nen Nervenzelle ihre funktionale
Bestimmung nicht ansehen kann,
lässt sich ihr Informationspoten-
tial nach der Art der verarbeiteten
Sinnesinformationen differenzie-
ren. Daraus wird deutlich, dass
Sinnesmedien wie Licht, Farbe, Ton
und Geruch das Material sind, aus
denen sich die Funktionalität der
Informationsverarbeitung im Gehirn
erklären lässt.
Am Ende der Verarbeitung steht die
Farbempfindung mit den Merkmalen
− Buntton (H) engl. Hue bzw.
Farbton
− Helligkeit (L) engl. Lightness
− Sättigung (C) engl. Chroma
Licht- Allgemein
So wie die Wirkung der Farbe auf
den Menschen, so ist auch Licht
mit vielen Wissenschaften und
Fachgebieten verknüpft. So finden
wir es beispielsweise in der Psy-
chologie, Physiologie, Biologie, vi-
suellen Ergonomie, Medizin, Chemie
Elektronik und Physik. Es formuliert
Architektur und verknüpft sich äs-
thetisch mit dem Empfinden des
Schalls und direkt oder indirekt des
Klimas.
Die natürliche vorkommende Form
von Licht ist das Sonnenlicht, aber
auch in Form vielfältiger künstli-
cher Leuchtmittel nehmen wir Licht
wahr.
Das natürliche Tageslicht bildet
das gesamte sichtbare Spektrum
elektromagnetischer Strahlung von
ungefähr 400 - 780 nm gleichzeitig
ab. Am hellsten wird eine Strahlung
mit einer Wellenlänge von 555 nm
(Farbe gelb-grün) empfunden.
Je mehr die Wellenlängen des Lich-
tes davon nach oben oder nach
unten abweicht, umso stärker sinkt
die spektrale Hellempfindlichkeit
des Sehapparates, um schließlich
bei 380nm (blau) bzw. bei 780nm
(rot) den Wert null zu erreichen.
Mit abnehmender Gesichtsfeld-
leuchtdichte wird das Auge für kurz-
welliges Licht empfindlicher als für
langwelliges Licht (Bilder 2 und 3).
Bild 1: Strahlungsverteilung vom Tageslicht
Bild: Waldmann














